Künstliche Intelligenz in Duisburg | Über »ZaKI.D« und den Technologietransfer in der Region

In Duisburg entsteht ein Leuchtturmprojekt, das die Zukunft der Künstlichen Intelligenz maßgeblich mitgestalten soll: das Zentrum für angewandte Künstliche Intelligenz Duisburg, kurz ZaKI.D. Als Teil des »5-StandorteProgramms« bündelt ZaKI.D Kompetenzen aus Forschung, Wirtschaft und Bildung, mit dem Ziel, bestehende KI-Technologien in die Anwendung zu bringen – besonders für kleine und mittlere Unternehmen. Mit ihrer fachlichen Expertise gestalten Wolfgang Gröting [WG], Gesamtprojektleiter von ZaKI.D, und Ole Werger [OW], verantwortlich für die Entwicklung konkreter KI-Anwendungen, vom Fraunhofer IMS das Projekt entscheidend mit. Im Interview geben sie Einblicke in Chancen und Herausforderungen von ZaKI.D, und erklären wie aus regionaler Forschung nachhaltige Impulse für die Wirtschaft entstehen können.
Herr Gröting, wie kam es zu dem Projekt ZaKI.D und was sind die generellen Ziele des Zentrums?
[WG]: ZaKI.D ist Teil der sogenannten »STARK-Förderlinie« des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Dieses Programm unterstützt gezielt Regionen im Strukturwandel, etwa ehemalige Kohlestandorte, beim wirtschaftlichen und technologischen Umbau. Dadurch sollen neue Impulse gesetzt und Zukunftstechnologien in den Regionen verankert werden. Unser Ziel mit dem ZaKI.D ist es, das Thema Embedded KI in die regionale Wirtschaft zu bringen, also nach Duisburg und Umgebung. Das machen wir am Fraunhofer IMS natürlich nicht allein. Wir arbeiten eng mit der Universität Duisburg-Essen und der Firma KROHNE Messtechnik GmbH zusammen.
Um unsere gemeinsamen Ziele umzusetzen, haben wir das Zentrum in drei zentrale Säulen gegliedert. Die erste Säule bilden die Umsetzungsprojekte. Die ZaKI.D-Akademie ist die zweite Säule. Hier geht es darum, Unternehmen nicht nur praktisch zu unterstützen, sondern ihnen auch mit Aus- und Weiterbildungsangeboten zu helfen, ein grundlegendes Verständnis für KI-Anwendungen zu entwickeln und eigene Optimierungspotenziale zu erkennen.
Die dritte Säule ist unser KI-Innovationsinkubator. Damit unterstützen wir gezielt Start-ups, die sich im Bereich Embedded KI weiterentwickeln wollen. Unser Fokus liegt dabei klar auf der technischen Unterstützung.
Herr Werger, lassen Sie uns direkt auf die Umsetzungsprojekte zu sprechen kommen. Was hat es mit denen auf sich?
[OW]: Bei den Umsetzungsprojekten ist geplant, dass wir in den nächsten Jahren insgesamt zwanzig kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Duisburg durch verschiedene Projekte unterstützen. Diese Unternehmen kommen oft ohne jegliche KI-Erfahrung zu uns und fragen: »Wie können wir mit Künstlicher Intelligenz unsere bestehenden Prozesse verbessern und effizienter gestalten?«
Spannend ist das natürlich auch im Kontext des Fachkräftemangels. Viele Unternehmen sehen sich mit dem Problem konfrontiert, dass nicht genug qualifizierte Fachkräfte vor Ort sind, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. KI kann hier nicht nur den digitalen Wandel vorantreiben, sondern auch helfen, Arbeitsprozesse zu optimieren und die vorhandenen Mitarbeiter:innen zu unterstützen.
Wie genau läuft so ein Umsetzungsprojekt ab?
[OW]: Eine Zusammenarbeit mit dem ZaKI.D beginnt immer mit einem Erstgespräch, in dem wir das Unternehmen kennenlernen. Mithilfe verschiedener Analysetools identifizieren wir gemeinsam die zentralen Kernprozesse und prüfen, an welchen Stellen der Einsatz von KI grundsätzlich sinnvoll ist.
Anschließend arbeiten wir einige Monate eng mit dem KMU zusammen. In dieser Phase stellen die Unternehmen vor allem ihre Mitarbeitenden und ihr Fachwissen zur Verfügung, damit wir ein tiefes Verständnis für ihre Abläufe gewinnen. Am Ende dieses Zeitraums erhalten sie einen Machbarkeitsnachweis, der aufzeigt, ob und wie sich KI in ihre Prozesse integrieren lässt. Wir folgen dabei dem Prinzip des Proof of Concept – das heißt, wir testen, ob eine KI-Anwendung praktisch funktioniert und wie sie konkret realisierbar ist. Wichtig ist: Wir liefern kein fertiges Produkt, sondern schaffen eine fundierte Grundlage für die weitere Verbesserung der Unternehmensprozesse. Diese Unterstützung ist für die Unternehmen natürlich kostenfrei, was gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einen großen Anreiz bietet.
Wie sieht so ein KI-Projekt in der Praxis konkret aus?
[OW]: Die Projekte sind nie »von der Stange«, sondern werden individuell auf die jeweiligen Unternehmen und ihre Fragestellungen zugeschnitten. Ein erstes Projekt ist bereits vollständig abgeschlossen. Es handelt sich um eine Zusammenarbeit mit der Firma Häuser & Co. GmbH, einem Unternehmen aus der Stahlrohrveredelung. Bisher saßen dort einige Mitarbeitende acht Stunden lang vor den Stahlrohren und überwachten den Einbrennprozess – eine monotone und anspruchsvolle Tätigkeit. Die Idee war, diesen Prozess mithilfe von KI zu unterstützen oder sogar zu automatisieren. Dazu musste zunächst erkannt werden, wie weit der Brennvorgang zu einem bestimmten Zeitpunkt fortgeschritten ist. Genau an dieser Stelle kam die KI ins Spiel: Wir haben ein Tool entwickelt, das den Fortschritt des Prozesses analysiert und auswertet. Damit konnten wir gezielte Steuersignale erzeugen und so einen Teil der Arbeit automatisieren. Das Projekt zeigt sehr gut, wie wir mit KI einen konkreten, realen Prozess im Unternehmen analysieren, bewerten und gezielt verbessern können.
Welche Erfahrungen oder Lösungsansätze aus den bisherigen Projekten lassen sich auf zukünftige Vorhaben übertragen? Gibt es auch technische Elemente, die sich wiederverwenden oder skalieren lassen?
[OW]: Ja, aus den bisherigen Projekten können wir auf mehreren Ebenen wichtige Erkenntnisse mitnehmen. Zum einen ist da der menschliche Aspekt: Die Frage, wie Mitarbeitende auf KI reagieren, ist in der Praxis sehr spannend. Es gibt oft Vorbehalte, etwa dass KI Arbeitsplätze gefährdet oder die tägliche Arbeit negativ verändert. Unsere Erfahrungen zeigen aber: Wenn man Mitarbeitende frühzeitig einbindet und transparent kommuniziert, kann KI auch als willkommene Unterstützung wahrgenommen werden – vor allem bei Routineaufgaben. Viele Beschäftigte äußern sogar den Wunsch, sich stärker auf anspruchsvolle, individuelle Aufgaben konzentrieren zu können, wenn KI ihnen im Alltag zur Seite steht.
Zum anderen lernen wir auch auf technischer Ebene viel. Bei ZaKI.D geht es weniger um Grundlagenforschung, sondern um konkrete Anwendungen – also darum, bestehende KI-Algorithmen so weiterzuentwickeln, dass sie unter realen Bedingungen funktionieren. Anders als im Forschungslabor arbeiten wir hier nicht auf der »grünen Wiese«, sondern in echten Unternehmensumgebungen – mit all ihren Herausforderungen. Und genau das macht unsere Arbeit so praxisrelevant: Wir sehen, was funktioniert, und was angepasst werden muss.
[WG]: Und ja, wir können Ergebnisse natürlich auch übertragen. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Projekt im Handwerksbereich, bei dem es um automatisierte Aufmaßerstellung ging. Der Betrieb selbst hat uns signalisiert: Wenn das bei uns funktioniert, dann funktioniert es eigentlich bei allen SHK‑Betrieben (Sanitär, Heizung, Klima) ähnlich. Wir arbeiten sogar gemeinsam daran, diese Lösung über die Kreishandwerkerschaft zu verbreiten.
Auch auf technischer Ebene gibt es gewisse Ansätze zur Wiederverwendung. Wenn wir zum Beispiel Kameras einsetzen oder Bilddaten auswerten, dann lässt sich zumindest ein Teil der eingesetzten Hardware oder Vorverarbeitungsschritte übertragen. Die Software hingegen muss meist individuell auf die Anforderungen angepasst werden – mal geht es um Glanz auf einem Rohr, ein anderes Mal um die Erkennung von Störelementen in einem ganz anderen Umfeld.
Wo wir gerade bei den Anwendungsbereichen sind: Für welche Unternehmen ist das Angebot von ZaKI.D interessant? Gibt es bestimmte Branchen, auf die Sie sich konzentrieren – oder ist das Spektrum eher breit gefächert?
WG]: ZaKI.D ist als regionales Projekt konzipiert – wir wurden, wie schon erwähnt, von der Stadt Duisburg unterstützt und sind Teil eines Förderprogramms, das gezielt einzelne Städte im Strukturwandel stärkt. Das bedeutet: Unser Fokus liegt klar auf Duisburg und der unmittelbaren Umgebung. Inhaltlich sind wir nicht komplett offen für alle Branchen, sondern konzentrieren uns auf Bereiche, die in Duisburg besonders stark vertreten und gleichzeitig besonders von der Transformation betroffen sind. Dazu zählen vor allem prozessnahe Industrie, Anlagentechnik, Produktionstechnik und die Metallverarbeitung. Diese Schwerpunktsetzung kommt nicht von ungefähr. Eine vorgelagerte Studie hat genau diese Sektoren als relevant für den Wirtschaftsstandort Duisburg identifiziert – sowohl in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung als auch in ihrer Betroffenheit vom Strukturwandel. Wir wollen mit ZaKI.D dort ansetzen, wo der Bedarf besonders groß ist und die Potenziale für den gezielten Einsatz von KI am höchsten sind.
Können Sie noch genauer erläutern, wie ZaKI.D zum Strukturwandel beiträgt?
[WG]: Es geht nicht nur darum, neue Technologien zu erforschen, sondern vornehmlich um konkrete Impulse für die wirtschaftliche Transformation. Dazu gehört unter anderem, qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, sowohl direkt im Projekt als auch indirekt über die Region hinaus.
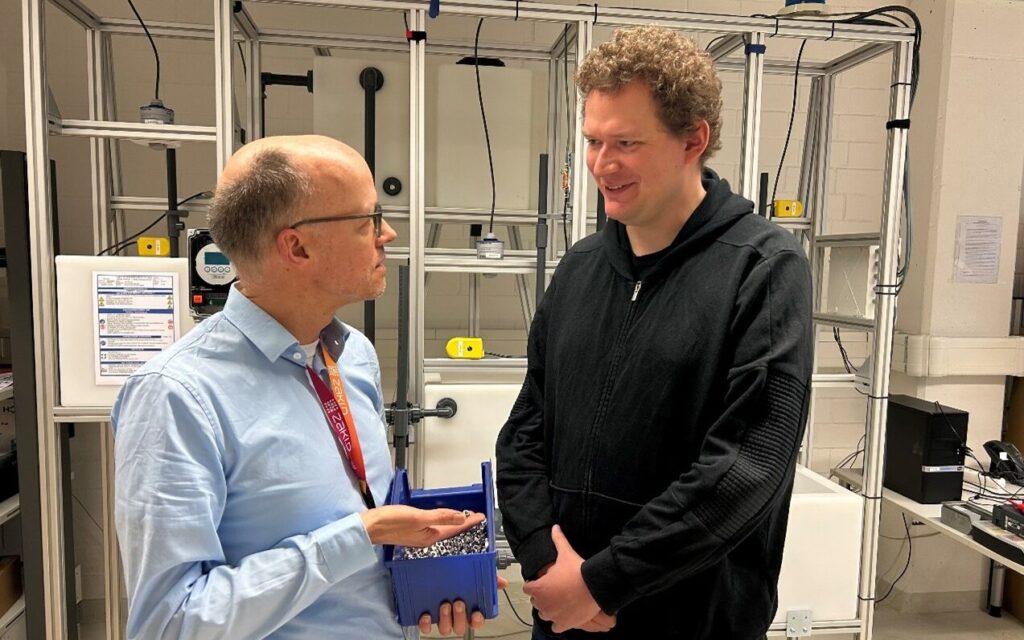
Allein durch das Zentrum entstehen in der ersten Projektphase 31 neue Arbeitsplätze. Darüber hinaus lässt sich auf Grundlage etablierter Berechnungsmodelle abschätzen, dass bis zu 500 indirekte Arbeitsplätze durch die angestoßenen Innovationen und Folgeeffekte entstehen könnten. Auch in Bezug auf die regionale Wertschöpfung ist der Einfluss erheblich. ZaKI.D ist ein Projekt mit einem Gesamtvolumen von knapp 19 Millionen Euro. Studien der Fraunhofer-Gesellschaft haben gezeigt, dass die Ansiedlung eines Fraunhofer-Instituts bzw. einer Fraunhofer-Initiative in einer Region messbar die Innovationskraft der umliegenden Unternehmen steigert – teils mit einem Faktor von 20 bei der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Kurz gesagt: ZaKI.D weniger ein Forschungsprojekt, sondern vielmehr ein aktives Instrument zur wirtschaftlichen und technologischen Erneuerung in einer Region, die im Strukturwandel ganz besonders gefordert ist.
Wie ist das Fraunhofer IMS konkret in ZaKI.D eingebunden – und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern, also der Universität Duisburg-Essen und KROHNE Messtechnik?
[OW]: Das Fraunhofer IMS übernimmt im Projekt ZaKI.D die Gesamtleitung. Das liegt vor allem daran, dass wir der größte Forschungspartner im Verbund sind. Viele übergreifende Aufgaben wie Kommunikation, Koordination oder Projektsteuerung laufen daher zentral über uns. Was die Umsetzungsprojekte betrifft, hat sich bislang gezeigt, dass wir die Projekte gut aufteilen konnten – teils aus fachlichen Gründen, teils weil es sich organisatorisch so ergeben hat. Am Fraunhofer IMS liegt der Fokus auf Projekten mit Bezug zu Embedded AI, also eingebetteter Künstlicher Intelligenz. Das passt auch zu unserem Kompetenzschwerpunkt am Institut, denn wir haben eine spezialisierte Abteilung für Embedded Software und KI, die hier sehr viel Know-how mitbringt.
Die beiden Lehrstühle der Universität Duisburg-Essen haben wiederum andere technologische Schwerpunkte – etwa eingebettete Systeme oder verteilte Architekturen. KROHNE bringt dagegen anwendungsnahe Industrieexpertise ein, vor allem im Bereich Sensorik und Messtechnik.
[WG]: Grundsätzlich gibt es bei uns eine eher dynamische Rollenverteilung, die sich mit der Zeit und abhängig von den Unternehmen weiterentwickelt. Denn natürlich schauen wir bei den Projekten ganz genau, welcher Partner fachlich und kapazitiv am besten passt. Wenn es sich um ein Thema handelt, zu dem KROHNE bereits ähnliche Erfahrungen hat, oder wenn es Parallelen zu früheren Projekten am Fraunhofer IMS gibt, nutzen wir diese Synergien. Inzwischen arbeiten wir auch an ersten Projekten, die gemeinsam mit mehreren Partnern umgesetzt werden.
Lassen Sie uns auf das erwähnte Schwerpunktthema Embedded AI zu sprechen kommen. Können Sie kurz erklären, was sich dahinter verbirgt und was diese Technologie so besonders macht?
[OW]: Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie vielfältig KI eigentlich sein kann. Die meisten kennen KI in Form von Sprachmodellen wie ChatGPT – also als große, cloudbasierte Systeme, mit denen man über den Browser interagiert. Dass es aber auch möglich ist, Künstliche Intelligenz direkt in kleinen, lokalen Geräten zu nutzen, überrascht viele unserer Gesprächspartner.
Genau hier setzt das Konzept der Embedded AI an. Um Embedded AI handelt es sich in der Regel, wenn künstliche Intelligenz auf Geräten läuft, die kleiner als ein Smartphone sind, und die lokal, energieeffizient sowie datenschutzfreundlich arbeiten. Die Daten müssen zudem nicht in eine Cloud übertragen, sondern können direkt im Unternehmen verarbeitet werden. Am Fraunhofer IMS entwickeln wir Lösungen, die speziell für diese lokalen, oft sehr kompakten Anwendungen konzipiert sind. In vielen Fällen arbeiten wir mit sehr kleinen, kostengünstigen Geräten, die direkt in Maschinen oder Sensoren integriert werden. Es gibt sogar schon Forschungsprojekte, in denen daran gearbeitet wird, auch die Hardware so zu gestalten, dass KI-Algorithmen besonders effizient darauf laufen. Das ist ein Bereich mit großem Potenzial – auch wenn wir bei ZaKI.D aktuell noch am Anfang stehen, was den praktischen Einsatz betrifft.
Warum ist Embedded KI ressourcenschonender als große Sprachmodelle (LLMs)?
[OW]: Große Sprachmodelle wie LLMs verbrauchen enorme Energiemengen – schon eine einfache Google-Anfrage benötigt viele Kilowattstunden und bei komplexen Sprachmodellen ist das noch extremer. Embedded KI dagegen arbeitet mit kleinen, speziell optimierten Modellen, die nur für eine konkrete Aufgabe ausgelegt sind. Weniger Parameter bedeuten kleinere Modelle, die schneller und effizienter laufen und keine teure Hardware wie Grafikkarten erfordern. Oft reicht bereits ein Mikrocontroller. Während LLMs viele überflüssige Funktionen beinhalten, ermöglicht Embedded KI maßgeschneiderte, ressourcensparende Lösungen. Auf Hardware-Ebene lässt sich Embedded KI sogar so weit treiben, dass Schaltungen speziell für eine Aufgabe entwickelt werden. Damit kann die Effizienz noch einmal massiv gesteigert werden, bis hin zu neuen Hardware-Designs, die die KI-Funktion direkt physikalisch abbilden.
Was macht das Zentrum ZaKI.D im Vergleich zu anderen KI-Initiativen oder Förderzentren besonders?
[WG]: Ich denke, was ZaKI.D besonders macht, ist vor allem die Kombination aus regionaler und anwendungsorientierter Fokussierung und gleichzeitig großer inhaltlicher Breite und Tiefe. Wir sind klar auf Duisburg und die Region ausgerichtet, und trotzdem relativ breit aufgestellt. Das erlaubt uns, nicht nur über KI und speziell Embedded AI zu sprechen, sondern diese Technologien konkret in die Anwendung zu bringen. Unsere Umsetzungsprojekte sind dafür ein gutes Beispiel: Wir begleiten Unternehmen über den gesamten Weg – von der ersten Idee über den Prototyp bis hin zur Qualifizierung der Mitarbeitenden. Diese direkte, praxisnahe Umsetzung ist in dieser Form eher selten.
Hinzu kommt: Wir haben bei ZaKI.D drei eigenständige Säulen, die ineinandergreifen. Neben den Umsetzungsprojekten haben wir die Akademie, in der wir begleitend Weiterbildungsangebote ermöglichen – oft direkt im Projektkontext. Wenn Unternehmen oder Mitarbeitende im Laufe eines Projekts an bestimmten Stellen noch Wissen aufbauen müssen, dann bieten wir das gezielt an. Und mit dem Inkubator richten wir uns auch an Start-ups, also an die Unternehmen von morgen. Gerade in diesem Bereich entstehen oft viele neue Arbeitsplätze, deshalb ist es wichtig, sie frühzeitig technologisch zu unterstützen.
Zusammengefasst: Wir haben mit ZaKI.D also einen klaren regionalen Fokus, einen praktischen Umsetzungsansatz, eine inhaltliche Spezialisierung auf Embedded AI und gleichzeitig die Möglichkeit, Weiterbildung und Start-up-Förderung unter einem Dach mitzudenken. Diese Kombination macht das Zentrum in Deutschland tatsächlich ziemlich einzigartig.
Wie genau funktioniert diese Akademie?
[WG]: Wie schon erwähnt, ist die Akademie ein eigenes Arbeitspaket, dessen Elemente die Umsetzungsprojekte ergänzen. Sie ist kein zusätzlicher, isolierter Bereich. Wir legen großen Wert darauf, dass die Weiterbildungsangebote genau auf die regionalen Bedürfnisse und die Unternehmen in Duisburg und Umgebung abgestimmt sind. Daher bieten wir verschiedene Kurse mit unterschiedlichen Anfangsvoraussetzungen an – von Einsteiger:innen bis zu Expert:innen. Ein wichtiger Punkt ist dabei die enge Zusammenarbeit innerhalb des Teams. So wird gewährleistet, dass die Weiterbildung nicht nur theoretisch ist, sondern auch ganz praktisch in die Arbeit der Unternehmen eingebunden wird.
Wie wichtig ist es, Nachwuchs für den Bereich KI zu gewinnen und Fachkräfte entsprechend auszubilden?
[OW]: Es gibt nur wenige Absolvent:innen mit KI-Schwerpunkt, besonders in der Informatik. Europa steht im Wettbewerb mit USA und Asien, daher ist der Aufbau lokaler Kompetenz entscheidend. Wir gehen deswegen aktiv auf Universitäten zu, rekrutieren auch über Abschlussarbeiten und gewinnen so junge, motivierte Forschende, die sich kontinuierlich weiterentwickeln, weil gerade das Thema KI täglich neue Impulse einbringt.
[WG]: Die Fraunhofer-Gesellschaft vermittelt vor allem jungen Fachkräften praxisnahe KI-Erfahrung, im Vergleich zu der eher theoretischen Arbeit an Universitäten. Wir wirken da wie ein Katalysator. Mitarbeitende sammeln Erfahrung und wechseln später oft in Unternehmen. So werden nicht nur Nachwuchskräfte gewonnen, sondern auch qualifizierte KI-Fachkräfte in die Wirtschaft weitergegeben.
Auch wenn das Projekt noch nicht so lange läuft: Gibt es bereits ein Highlight oder etwas, das Sie besonders hervorheben möchten?
[WG]: Besonders hervorzuheben ist, dass das Zentrum sehr gut von den Unternehmen sowie den Multiplikatoren (Wirtschaftsförderung, Unternehmensverbände, etc.) aufgenommen wird. Unternehmen kommen von selbst auf das Team zu, sodass wir kaum noch aktiv nach Projekten suchen müssen. Da spielt natürlich auch die sehr gute Zusammenarbeit mit bestehenden Netzwerken wie Duisburg Business & Innovation eine große Rolle, die uns Unternehmen weiterempfohlen und damit die Projektakquise erheblich erleichtert haben. Außerdem haben wir gute Strukturen entwickelt und Werkzeuge definiert. Es wurde ein Beirat installiert, der Projekte nach definierten Kriterien bewertet, sodass die Auswahl objektiv und im Sinne der Projektziele erfolgt.
[OW]: Ein persönliches Highlight ist auch die Vielfalt der Projekte. Schon bei den ersten Projekten zeigte sich eine breite thematische Streuung. Es gab nicht nur ähnliche Probleme aus demselben Umfeld. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen verstärkte sich auch die Resonanz und weitere Unternehmen möchten aktiv mit uns zusammenarbeiten.
Welche nächsten Schritte stehen jetzt im Projekt an?
[WG]: Hinsichtlich der Projektumsetzung ist vieles bereits etabliert und kann fast als »Running Machine« bezeichnet werden, auch wenn die konkreten Probleme und Anwendungen der Unternehmen immer unterschiedlich sind. Es gibt allerdings noch einige Vorhaben, die weiterentwickelt werden. Andere Themen wie zum Beispiel die Embedded AI-Community in Duisburg und Umgebung werden gerade erst aufgebaut. Erste Kontakte zu Start-ups wurden bereits geknüpft und Use Cases im Rahmen eines KI Explorers definiert, allerdings müssen wir hier die Dienstleistungen noch ausbauen. Darüber hinaus sind nationale und internationale Konferenzen geplant, um die Projektergebnisse einem größeren Publikum zu präsentieren. Insgesamt kombinieren die nächsten Schritte die laufende Projektarbeit mit dem strategischen Ausbau von Netzwerk, Services und Sichtbarkeit.