#Chip Happens-Podcast: Staffel 2, Folge 3 I Unser Trinkwasser
Große Probleme brauchen häufig ziemlich kleine Helfer. Der Podcast »Chip Happens – Kleine Dinge, die alles verändern« von Chipdesign Germany zeigt, wie Mikroelektronik und Chipdesign dabei helfen können, die drängenden Fragen unserer Zeit anzugehen – jederzeit nachvollziehbar und alltagsnah.
Das Format richtet sich an alle, die verstehen wollen, wie Technik im Hintergrund wirkt und dennoch zentrale Weichen stellt. Kluge Köpfe aus der Branche sprechen hierfür mit Moderator Sven Oswald über ihre faszinierenden Geschichten, geben überraschende Einblicke und zeigen hautnah die vielen Möglichkeiten, die unser Fachbereich bietet.
Wasser ist Leben. Und Mikroelektronik hilft uns, es zu finden, zu reinigen, zu überwachen und zu bewahren. In Staffel 2 von »Chip Happens«, dem Podcast von Chipdesign Germany, dreht sich alles um das Element Wasser – von der Tiefsee bis ins Weltall.
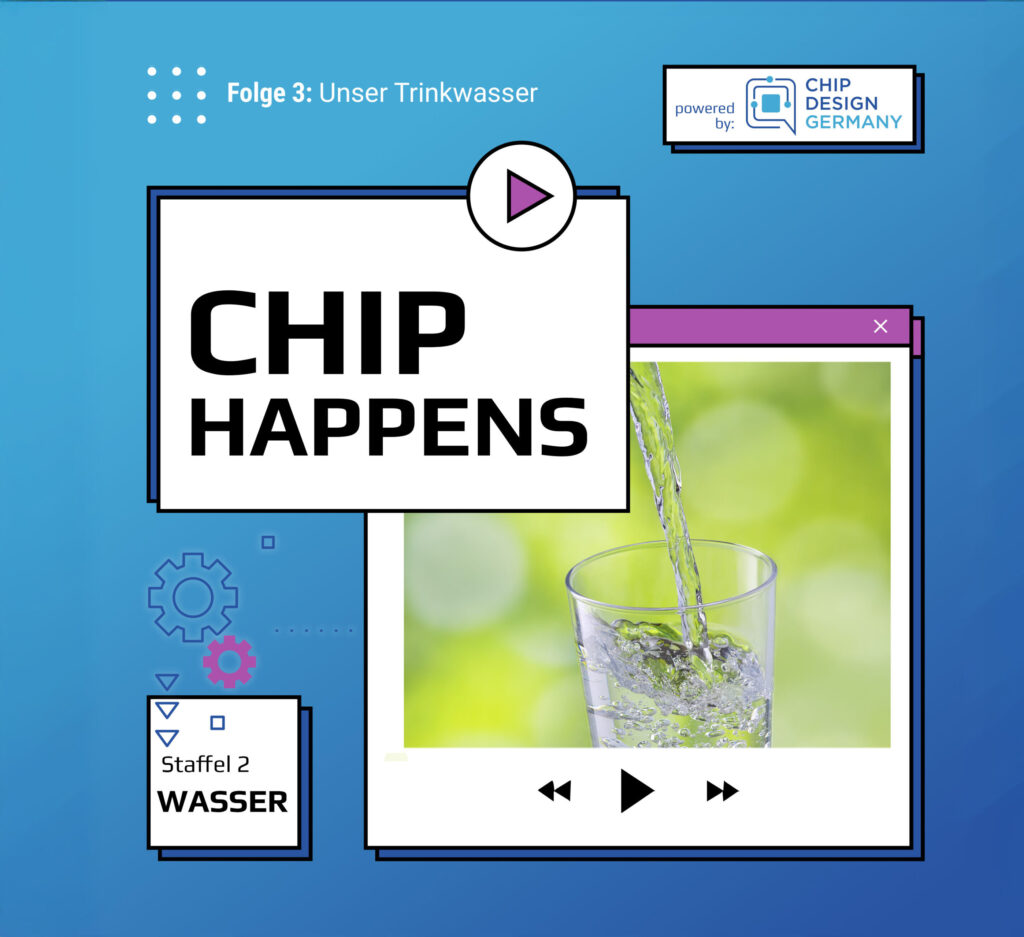
Staffel 2, Folge 3 I Unser Trinkwasser
In der dritten Folge dieser Staffel geht es um unser Trinkwasser, welches in Deutschland meist aus dem Grundwasser gewonnen wird. Unser Grundwasser regeneriert sich meist langsamer als wir es entnehmen, was zu einer Überbelastung dieser lebenswichtigen Ressource führt. Mit unseren Gästen sprechen wir heute über Wege, unser Grundwasser zu schützen und es sparsamer einzusetzen.
Zuerst reisen wir dafür nach Berlin, wo uns Stephan Natz, Pressesprecher bei den Berliner Wasserbetrieben, über den Wasserhaushalt der Hauptstadt, die dahinterstehende Infrastruktur und die Vorteile der Uferfiltration, die Speicherung in Reinwasserbehältern und die umfassende Überwachung der Wasserqualität durch Laborproben und Echtzeitmessungen berichtet.
Anschließend erklärt Susanne Liane Buck, Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation IAO, wie uns digitale Systeme beim Monitoring und Management unseres häuslichen Brauchwassers helfen können.
Zu guter Letzt spricht Jakob Reck, Projektmanager am Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, HHI, über photonische Sensoren zur Wasserprüfung, welche viele Vorteile gegenüber chemischen Verfahren bieten.
Worum geht es in der Folge?
Stephan Natz zum Berliner Wasserhaushalt: |
|
|---|---|
|
Situation: |
Berlin gewinnt sein Trinkwasser ausschließlich aus dem Pumpen von Grundwasser. Jedoch werden nur etwa 30 % unseres Verbrauchs, vor allem in den Wintermonaten, über den Niederschlag regeneriert. Die restlichen zwei Drittel des Grundwassers werden über die Uferfiltration regeneriert, bei der Teile des Spree- und Havelwassers versickern und das Grundwasser auffüllen. Neun Wasserwerke sichern die Versorgung Berlins. Durchschnittlich werden etwa 620.000 m³ am Tag verbraucht. |
|
Problemstellung: |
Die Wassernachfrage schwankt stark, zu unterschiedlichen Jahreszeiten, Tagen und Uhrzeiten. Am Ostersonntag wird mit unter 500.000 m³ beispielsweise meist am wenigsten Wasser verbraucht, während der letzten Hitzewelle im Juli waren es ~880.000 m³ am Tag. Die Versorgung muss trotz dieser Schwankungen jederzeit hygienisch und ausfallsicher bleiben, sodass das riesige Netz in der Stadt eine kontinuierliche Wartung benötigt. |
|
Lösungsansätze/Innovationspotenziale: |
Die Uferfiltration ist ein guter erster Garant für die Wasserqualität. Das Regen-, Spree- und Havelwasser fließt hierfür über Monate und Jahre durch viele Bodenschichten und wird so auf natürliche Weise gereinigt. Natürlich wird sich auf diesen Prozess nicht blind verlassen; ein Netz von Zehntausend Laborproben im Jahr sichert die Qualität wissenschaftlich ab. In den Wasserwerken gibt es zudem Echtzeit-Sensoren, welche die Wasserqualität anhand fünf verschiedener Parameter messen. Riesige Reinwasserbehälter puffern darüber hinaus Lastspitzen, ein einziger dieser Behälter kann einen ganzen Tagesverbrauch an Wasser aufnehmen kann. Zudem gibt es viele ausgewiesene Wasserschutzgebiete, mit denen die Räume zur Regeneration geschützt werden. Auch die konkrete Trinkwasserverordnung und regionale Geschmacksunterschiede durch Mineralien wie Eisen, Mangan, Calcium und Magnesium sowie die Instandhaltung des fast 8.000 Kilometer langen Rohr- und 9.800 Kilometer langen Kanalnetzes in Berlin werden von Stephan Natz besprochen. So wird das gesamte Netz mithilfe eines KI-Netzes überwacht, welches Daten zu den einzelnen Rohren kontrolliert und beispielsweise Empfehlungen zur Reihenfolge von Instandhaltungsmaßnahmen ausgibt. |
|
Weiterer Forschungs-/Entwicklungsbedarf / Aktuelle Projekte: |
Die Berliner Wasserbetriebe experimentieren zurzeit mit Bioindikatoren (u.a. speziellen Fischsorten, Bachflohkrebsen), um über Verhaltensänderungen auf die Wasserqualität zu schließen, diese Untersuchungsmethoden sind jedoch noch nicht serienreif. |
Susanne Buck zum digitalen Wassermanagement in unseren Haushalten |
|
|---|---|
|
Situation: |
Die zunehmende Urbanisierung sowie sich häufende Hitzeperioden verändern die Entnahmegewohnheiten in der gesamten Gesellschaft. Der mit dieser Erwärmung einhergehende Temperaturanstieg des Wassers in Leitungs- und Gebäudesystemen begünstigt gleichzeitig die Vermehrung von Keimen und rückt Hygiene noch stärker in den Fokus. Das Ziel für Haushalte muss es sein, eine saubere Wasserverfügbarkeit zur »richtigen« Zeit und eine bestmögliche Ressourceneffizienz zu erreichen. |
|
Problemstellung: |
Die Wasserversorger erhalten lediglich Makro-Daten zum Wasserverbrauch. Abgesehen von der jährlichen Zähler-Ablesung sind die Wohnhäuser quasi eine Black-Box für sie. Hier braucht es laut Susanne Buck eine bessere Datenlage darüber, wie Wasser in den Häusern und Wohnungen konkret genutzt wird. |
|
Lösungsansätze/Innovationspotenziale: |
In diesem Zuge spricht sie über das Projekt »Integrierte Digitalisierung der Trinkwasserversorgung – InDigWa« und wie integrierte Digitalisierung der Trinkwasserversorgung faktisch funktionieren kann. Sie erklärt dabei, wie digitale Lösungen helfen können, Verbrauch, Hygiene und Versorgung zu optimieren – mit der Vision einer Morgenstadt, in der Ressourcen immer effizienter genutzt werden. Über ein digitales Monitoring von Entnahmegewohnheiten können die benötigten Daten generiert werden, damit z. B. Warmwasser zur richtigen Zeit schon vorgewärmt werden kann. Ein anderer Ansatz ist die Nutzung von »Grauwasser«, also z. B. die Toilettenspülung mit altem Duschwasser zu betreiben. Auch außerhalb eines Wohnhauses können digitale Technologien und Mikroelektronik zum Einsatz kommen, so können z. B. Sensoren erkennen, wann und wie viel Wasser Bäume und Rasenflächen benötigen. |
|
Weiterer Forschungs-/Entwicklungsbedarf / Aktuelle Projekte: |
In Zukunft könnte man die Monitoring- und Steuerungssysteme in ein datengetriebenes KI-Umfeld integrieren. Dieses könnte, unter der Berücksichtigung von Hygiene und Effizienz, weitere Entscheidungen zu Verteilung und Nutzung von Wasser treffen. |
Jakob Reck zur Wasserprüfung mit Licht |
|
|---|---|
|
Situation: |
Klassische Wasseranalytik wird oft chemisch/elektrochemisch durchgeführt und benötigt Labore zur Auswertung von Proben. Diese Analyse können aufwendig, langsam und personalintensiv sein. |
|
Problemstellung: |
Da die traditionellen Prüfungen (z. B. auf Legionellen) oft teuer und langsam sind, gibt es Bedarf an schnellen, quantitativen Checks, welche direkt vor Ort durchgeführt werden können. |
|
Lösungsansätze/Innovationspotenziale: |
Die industrielle-Forschung arbeitet aktuell daran, die Kosten einzelner photonischer Sensoren zur Analyse in den einstelligen Euro-Bereich zu drücken sodass diese problemlos vor Ort genutzt werden können. Photonische Sensoren sind winzige, chipbasierte Lichtwellenleiter, die ihre Farbe bei Kontakt mit bestimmten Stoffen ändern. So ermöglichen sie schnelle, präzise und kostengünstige Messungen direkt vor Ort – ohne den Umweg über das Labor. |
|
Weiterer Forschungs-/Entwicklungsbedarf / Aktuelle Projekte: |
Diese Sensoren können, je nach Ausrichtung und Funktionalität, auch in den Life-Sciences, für Drogentests oder beim Monitoring von Meerwasser eingesetzt werden. |
Zur dritten Folge der zweiten Staffel – Unser Trinkwasser (Spotify):
In der nächsten Woche befassen wir uns mit dem Meerwasser, welches durch Überfischung, Algenwachstum und Versalzung heute immer stärker gefährdet ist.

