Highspeed dank Photonen | Über lichtbasierte Chiptechnologie und das Schlüsselmaterial Indiumphosphid
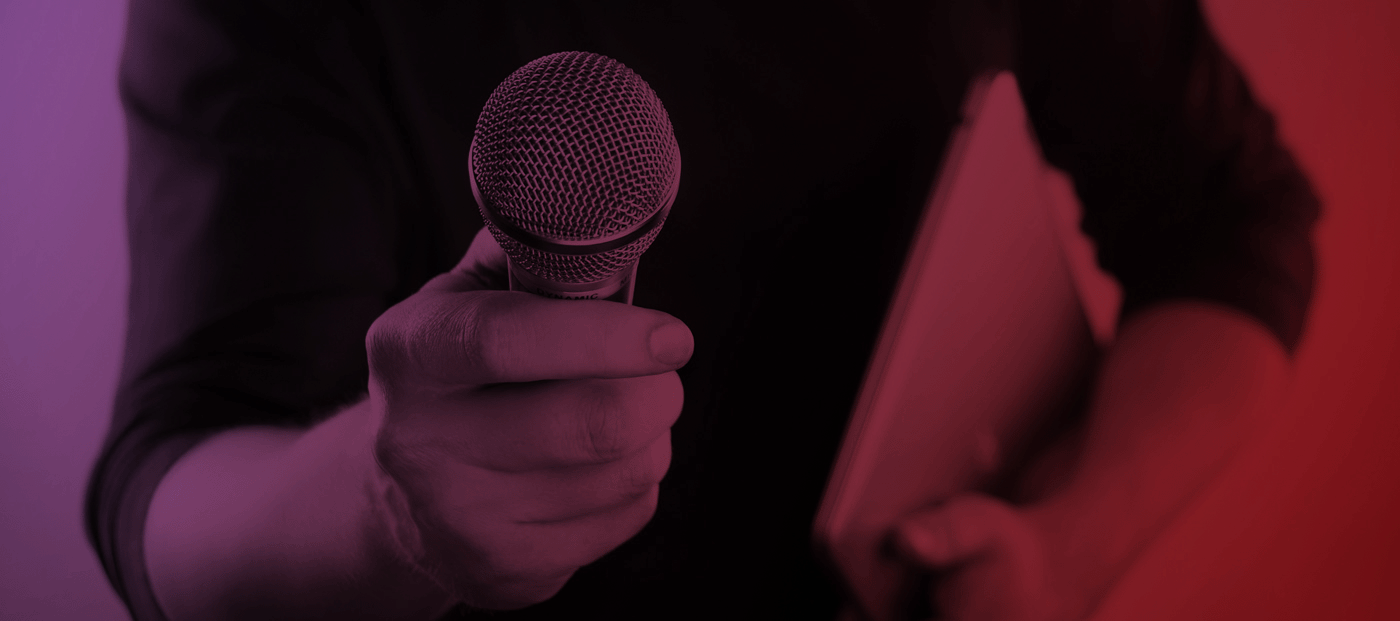
Wie wird ein Chip eigentlich hergestellt? Und was macht Indiumphosphid für den Prozess so besonders? Dr. Kristijan Posilovic, Abteilungsleiter für Technologie und Infrastruktur am Fraunhofer HHI, gibt im Interview Einblicke in die Welt der (photonischen) Chips und erklärt, warum diese für Anwendungen in Telekommunikation, Gasdetektion oder Hochleistungslasern so entscheidend sind. Zwischen Reinraum, Lasern und Halbleiterschichten schaffen Dr. Kristijan Posilovic und sein Team mit modernster Fertigungstechnologie die Grundlage für die Datenkommunikation der Zukunft.
Herr Dr. Posilovic, Sie leiten die Abteilung Technologie und Infrastruktur am Fraunhofer HHI. Woran arbeiten Sie und Ihr Team genau?
Wir bieten die notwendigen Services für die Herstellung von sämtlichen photonischen Komponenten bzw. Halbleiterchips, die am Fraunhofer HHI hergestellt werden. Unsere Abteilung ist quasi eine Art technologisches Rückgrat der Chipherstellung. Aus Designs und Ideen der Wissenschaftler:innen aus Projektgruppen stellen wir Hardware her, also Chips, die gemessen werden können. Diese Chips können dann weiter in Gehäuse gepackeged und schließlich an Kunden verkauft werden.
Sie arbeiten in Ihrer Abteilung u. a. an photonischen Chips. Können Sie erklären, worum es sich dabei handelt – und was diese Chips von klassischen elektronischen Chips unterscheidet?
Photonische Chips nutzen Licht, also Photonen statt Elektronen, um Informationen zu verarbeiten oder zu übertragen. Damit das funktioniert, müssen wir natürlich auch auf andere Halbleitermaterialien zurückgreifen. Während klassische Mikroprozessoren meist auf Silizium basieren, setzen wir bei photonischen Komponenten z. B. insbesondere auf Indiumphosphid. Dieses Halbleitmaterial hat die besondere Eigenschaft, dass es Licht emittieren kann. Das bedeutet, dass bei der korrekten Zusammenstellung des Chips durch Anlegen einer elektrischen Spannung Licht erzeugt wird. Je nachdem, wie die Materialschichten im Design kombiniert werden, entsteht dann aus einem photonischen Chip ein Laser, ein Photodetektor, ein Modulator oder auch ein komplizierter photonisch integrierter Schaltkreis.
Wie läuft die Herstellung eines photonischen Chips typischerweise ab – vom Design bis zum fertigen Modul?
Die Herstellung eines photonischen Chips ist ein hochkomplexer, mehrstufiger Prozess. Die Fertigung startet mit dem Indiumphosphid-Substrat, auf dem durch Epitaxie weitere Materialschichten aufgebracht werden. Dabei werden verschiedene, zum Indiumphosphid passende Materialien aufgewachsen. Dieser Prozess macht das gezielte Einstellen von Parametern wie Materialzusammensetzung, Schichtdicke und mechanischen Spannungen, die die physikalischen Eigenschaften des späteren Bauelements wesentlich bestimmen, möglich. So entsteht ein vertikaler Schichtaufbau, bei dem jede Schicht präzise aufeinander abgestimmt ist. Nach dem Epitaxie-Prozess haben wir dann einen Wafer mit den gewünschten Schichten, aber noch lange kein funktionales Bauelement, also keinen Chip.
Im nächsten Schritt durchlaufen die Wafer den Frontend-Bereich unseres Reinraums. Dort kommen die klassischen Verfahren aus der Mikroelektronik zum Einsatz: Lithografie, Beschichtung, Trocken- und Nassätzen sowie Metallisierung. Je nach Komplexität des Designs dauert diese Phase zwischen vier Wochen und vier Monaten. Anschließend beginnt im Backend die Vorbereitung zur Lichtauskopplung. Die Wafer werden hier in sogenannte Barren gespalten, also in eine Art Halbleiterstreifen mit glatten Kristallflächen, die wie Spiegel wirken. Über diese kann Licht aus dem Chip heraus oder hineingeleitet werden. Die Spiegelflächen werden im Backend optisch vergütet, also entspiegelt, ähnlich wie man es von Brillengläsern kennt.
Im letzten Schritt werden die Barren in einzelne Chips separiert. Diese werden anschließend in die Aufbau- und Verbindungstechnik zu kompakten Modulen weiterverarbeitet. Solche Module haben z. B. Glasfaseranschlüsse und elektrische Kontakte. Erst in dieser Form können unsere Kunden die Chips tatsächlich einsetzen.
Welche Rolle spielt die hybride Integration in der photonischen Chipentwicklung?
Hybride Integration spielt eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung. Ein Beispiel: Wir kombinieren Laserchips aus Indiumphosphid, die eine bestimmte Wellenlänge emittieren, mit einer Polymerplattform, die optische Netzwerke wie Wellenleiter, Schalter oder Filter beinhaltet und es ermöglicht, mit dem Licht zu arbeiten. So werden zwei unterschiedliche Technologien miteinander verbunden, nämlich das Indiumphosphid mit z. B. dem Polymer. Das sind Materialien, mit denen wir derzeit noch ein wenig experimentieren und die wir weiterentwickeln. Wir sind aber bereits in der Lage, solche hybriden Lösungen anzubieten.
Wie viele Chips lassen sich aus einem Polymer gewinnen?
Das ist sozusagen die Gretchenfrage, denn das hängt maßgeblich von den Chipdimensionen ab. Die kleinsten Chips, die Laserchips, sind etwa doppelt so breit wie ein menschliches Haar. Auf einem 3- bis 6-Zoll-Wafer entstehen davon Hunderttausende. Unsere größten Chips hingegen bewegen sich im Zentimeterbereich. Von diesen lassen sich auf einem 3-Zoll-Wafer etwa sieben Stück realisieren.

Muss pro Wafer ein einheitliches Chipdesign verwendet werden, oder können unterschiedliche Designs auf demselben Wafer integriert werden?
»Ja, das ist möglich, insbesondere auf unserer Multi-Wafer-Plattform. Dort können mehrere Designs gleichzeitig auf einem gemeinsamen Wafer gefertigt werden. Einzelne Kunden belegen jeweils bestimmte Bereiche des Wafers – so lässt sich etwa in einem Segment ein Laser integrieren, während in einem anderen ein Modulator oder ein Wellenlängenfilter realisiert wird. Diese parallele Fertigung verschiedener Designs auf einem Wafer bietet unseren Partnern eine kosteneffiziente Möglichkeit, auch kleinere Stückzahlen oder Prototypen umzusetzen. Wir stellen dann dafür die technologischen Tools her.«
Lassen Sie uns noch einmal einen Blick auf das Thema Material werfen. Sie sagten bereits, dass bei Ihnen vor allem mit Indiumphosphid gearbeitet wird. Was genau macht das Material für photonische Chips so besonders?
»Indiumphosphid ist ein sogenannter III-V-Verbindungshalbleiter und damit physikalisch etwas ganz anderes als Silizium. Ein zentraler Unterschied liegt in der Art der Bandstruktur. Indiumphosphid ist ein direkter Halbleiter und Silizium ein indirekter Halbleiter. Das hat sehr konkrete Auswirkungen: Silizium kann keine Photonen emittieren.
Indiumphosphid eignet sich dafür hingegen hervorragend. Wird elektrische Spannung angelegt, emittiert das Material effizient Licht. Der große Vorteil von Indiumphosphid ist, dass seine »Bandlücke« in dem Wellenlängenbereich liegt, wo Glasfasern ihr absolutes Absorptionsminimum haben – also dort, wo Licht besonders verlustarm übertragen wird. Das ist essenziell für die optische Datenübertragung, etwa in der Telekommunikation oder bei transkontinentalen Glasfaserkabeln. Für solche Anwendungen sind also ganz bestimmte Wellenlängen erforderlich – und Indiumphosphid ist das einzige Material, das diese physikalisch ermöglicht.«
Silizium lässt sich aus Quarzsand gewinnen. Wie verhält es sich bei Indiumphosphid – woher stammen die Rohstoffe, und wie aufwendig ist die Herstellung des Substratmaterials?
Genau, Silizium-Wafer lassen sich im Prinzip aus Sand herstellen, also aus Siliziumoxid, das in der Natur häufig auftritt. Bei Indiumphosphid ist es ähnlich: Indium ist ein seltenes Metall, das in der Erdkruste vorkommt, und Phosphor wird aus Phosphatgesteinen gewonnen. Um daraus ein geeignetes Substrat herzustellen, müssen Indium und Phosphor jedoch zu einem perfekten Einkristall verbunden werden. Dieser Prozess ist deutlich aufwendiger als bei Silizium.
Die Silizium-Substratherstellung ist dem Indiumphosphid um etliche Jahrzehnte voraus und technologisch sehr weit entwickelt. Während in der Siliziumindustrie heute Wafer mit 200 Millimeter oder 300 Millimeter Durchmesser Standard sind, bewegt sich Indiumphosphid noch in einem Bereich von 3 bis 4 Zoll. Das entspricht 75 mm bis 100 mm. Im Vergleich zu Silizium ist das ein erheblicher Unterschied in der verfügbaren Fläche und in der industriellen Skalierbarkeit.
Um die Kosten zu minimieren, sind viele Hersteller bestrebt, mindestens 6-Zoll-Indiumphosphid herzustellen. Auch wir testen gerade viel mit 6-Zoll-Indiumphosphid, aber die Qualität dieser größeren Substrate ist noch nicht auf dem Niveau, das für eine breite industrielle Nutzung erforderlich wäre.
Das heißt, die Herstellung größerer Wafer ist eine Herausforderung. Welche sind die Hauptfaktoren, die den Prozess des Wachstums eines Indiumphosphid-Wafers auf größere Größen erschweren?
Beim Indiumphosphid besteht das Problem darin, dass Indium ein leicht schmelzbares Metall ist, während die Phosphorkomponente aus der Gasphase kommt. Das heißt, um ein Indiumphosphid-Kristall aus diesen beiden Elementen zu wachsen, werden relativ hohe Temperaturen benötigt, die aber noch beherrschbar sein müssen. Zusätzlich ist unglaublich hoher Druck auf einer großen Fläche erforderlich, um ein 8 Zoll Indiumphosphid-Ingot (große kristalline Blöcke des Materials, die später in dünne Wafer geschnitten werden) aus der Schmelze zu ziehen. Das größere Problem ist jedoch, dass das Material eine höhere Neigung zu Rissen und strukturellen Defekten aufweist, wenn der Ingot zu groß wird. Das Indiumphosphid muss unter sehr spezifischen Bedingungen kristallisieren, und je größer der Wafer, desto schwieriger wird es, diese Bedingungen konstant zu halten. Ein zu großer Ingot führt oft zu unerwünschten Spannungen im Kristallgitter, was die Qualität des Wafers beeinträchtigt und die Herstellung größerer Wafer technisch unpraktisch macht. Daher ist das Wachstum größerer Wafer bei Indiumphosphid aus materialwissenschaftlicher Sicht deutlich anspruchsvoller als bei Silizium.
Nachdem wir die technische Seite betrachtet haben, lassen Sie uns noch etwas über die Anwendungsbereiche sprechen. Sie haben schon erwähnt, dass die photonischen Chips für Glasfaser genutzt werden. Wo kommen Sie noch zum Einsatz?
Das Indiumphosphid hat seinen Ursprung vor allem im Datakommunikations- und Telekommunikationsbereich, was mit seiner Fähigkeit zusammenhängt, die passenden Wellenlängen für optische Übertragungen bereitzustellen. Angesichts des immer größer werdenden Datenaufkommens durch Internet, Streaming oder KI wächst der Bedarf an Indiumphosphid exorbitant und dieser Bedarf wird auch anhalten. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass die Glasfasernetze, die mit wirklich hohen Investitionen installiert worden sind, nicht neu verlegt werden können. Deshalb müssen die Sende- und Empfangskomponenten dieser Netze effizienter gestaltet werden. Um den immer höheren Anforderungen gerecht zu werden, müssen wir sicherstellen, dass die Detektoren bei Frequenzen von bis zu 150 GHz zuverlässig arbeiten. Diese Photodetektoren können Lichtpulse im Pikosekundenbereich erfassen, das entspricht nur wenigen Millimetern Lichtausbreitung – das ist echte High End-Technologie. Neben den Photodetektoren entwickeln wir auch Modulatoren für die Datenkommunikation. Darüber hinaus findet Indiumphosphid auch Anwendung im Bereich der Gasdetektion, wo es darum geht, ganz spezifische Wellenlängen zu erzeugen, um bestimmte Gase zu identifizieren. In diesen Fällen liefern wir unseren Kunden maßgeschneiderte Laser, die exakt den Anforderungen entsprechen.
Ein weiterer wachsender Bereich, in dem Indiumphosphid zunehmend zum Einsatz kommt, sind High-Power-Laser. Hier spielen vor allem hohe Leistung, Effizienz und Kosteneffektivität eine zentrale Rolle. Beispielsweise gibt es Anwendungen, die Halbleiterlaser nutzen, um andere Laser mit Energie zu versorgen. Aktuell sind solche Fusionsexperimente ein großes Thema.
Was sind weitere Trends oder nächste Ziele in dem Feld, die sich abzeichnen? Was wäre revolutionär oder wichtig?
In den nächsten Jahren werden garantiert KI-Datenzentren das beherrschende Thema sein. Jeder kennt ChatGPT und gefühlt wöchentlich tauchen neue KI-Tools auf. In Hinblick darauf wird Energieeffizienz immer wichtiger werden.
Es gibt unterschiedliche Prognosen, die besagen, in 10 bis 15 Jahren werden 20 bis 40 Prozent des Energiebedarfs eines Landes nur durch Unternehmen wie Google verbraucht. Daran müssen wir schon heute denken und dieser Herausforderung begegnen. Und hier kann das Thema Chipherstellung einen wichtigen Beitrag leisten. Wenn ein Chip 10 Prozent weniger Strom verbraucht oder wir es schaffen, 80.000 Chips aus einem Wafer zu produzieren, können wir einen signifikanten Beitrag leisten. Manchmal sagen wir »Green Photonics« dazu.
Zum Abschluss nochmal etwas Persönliches: Was macht Ihnen am meisten Spaß bei der Arbeit?
Als Abteilungsleiter bin ich leider viel zu selten im Reinraum, aber ich liebe die Arbeit dort. Die Welt der Reinraum-Technologie und Halbleiterfertigung fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Es gibt ständig neue, hochmoderne Maschinen und Technologien, die wir direkt erleben und nutzen – z. B. Strukturen, die wir mit unserem Elektronen-Strahlschreiber in Dimensionen von 2 bis 5 Nanometern herstellen. Für die meisten Menschen ist es kaum vorstellbar, in solch winzigen Maßstäben zu arbeiten. Davon abgesehen habe ich ein großartiges Team. Und wenn nach vielleicht drei Monaten ein Wafer aus der Fertigung kommt, der erfolgreich beim Kunden getestet wird und dieser begeistert ist, dann ist das einfach unglaublich motivierend. Solche Momente machen die Arbeit besonders spannend und erfüllend.
